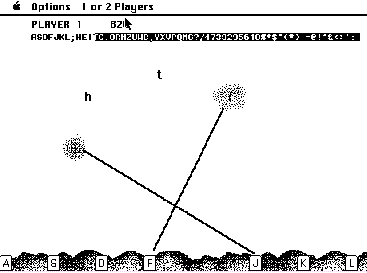Peter Matussek Der elektronische Eckermann. Es gibt ein Computerspiel, das 'Letter Invaders' heißt. Es ist Teil eines Programms, mit dem sich das Maschineschreiben lernen läßt: Alphanumerische Zeichen fallen wie Sprengköpfe vom Bildschirmhimmmel herab und der Spieler muß sie durch das Eintippen der richtigen Zeichen vernichten. Die Buchstaben zerstören sich gegenseitig wie SDI-Raketen. Dieses Star Wars -Szenario wird in einer Passage aus Gundolf S. Freyermuths Thriller 'Der Ausweg' zum Symbol literarischer Selbstreflexion: Harry Mann ging hinüber in sein Arbeitszimmer und schaltete den Computer ein. Ein paar Runden mit seinem Lieblingsspiel 'Letter Invaders' würden ihn ablenken. Über dreißigtausend Punkte hatte er bereits gemacht, immer schneller sausten die verrückten Worte auf das Reich der Sprache herab und suchten es zu verderben; immer mehr wurden von ihm, dem Rechtschreib-Verteidiger, abgeschossen, immer mehr aber der elektronischen Kamikazekommandos kamen auch durch... Harry Mann verteidigt an der Computertastatur das Reich der Sprache gegen die Macht der Diskurse – so übersetzt Freyermuth die alte Metapher von der Waffe der Literatur ins Zeitalter der elektronischen Medien. War es in früheren Epochen das Aufspießen mit spitzer Feder oder das Abrattern von Schreibmaschinensalven, mit dem die literarischen Waffengänge geführt wurden, so sind es nun die Fernlenkgeschosse der Tastatureingaben. High Tech tritt an die Stelle früherer Schreibtechniken. Was folgt daraus für die Literatur? Verkommt sie auf den Kathodenstrahl-Displays zum neoncoolen High Text? Aber was ändert sich denn schon im Prinzip? Das Lieblingsspiel Harry Manns teilt mit dem Lieblingsspiel Ronald Reagans eine Grundregel, die Cicero bereits in Umlauf brachte: Gleiches mit Gleichem zu beantworten. So wie die verschiedenen Waffensysteme sich gegenseitig vernichten, so befindet sich auch die Schrift in einem beständigen Vernichtungskrieg gegen die Schrift. Hier wie dort sucht jeweils neueste Technik die ältere zu überwinden: Schon das Alphabet ist eine instrumentelle Abstraktion, die den individuellen mimetischen Gehalt, der noch den Piktogrammen eigen war, eliminierte. Zugleich ermöglichte es neue Formen der Individuation; für Heraklit ist die Buchstabenschrift überhaupt erst "des Daseins eigentlicher Anfang". Platon wiederum rechnet ihr im Duktus einer frühen Technikfolgenabschätzung vor: Denn diese Erfindung wird die Lernenden in ihrer Seele vergeßlich machen, weil sie dann das Gedächtnis nicht mehr üben; denn im Vertrauen auf die Schrift suchen sie sich durch fremde Zeichen außerhalb, und nicht durch eigene Kraft in ihrem Innern zu erinnern. Ein bemerkenswerter Satz, - der ohne die geschmähte Erfindung wohl in Vergessenheit geraten wäre. Keine technikkritische Schrift fortan, ob auf Papyrus gekritzelt oder auf Papier gedruckt, die nicht schon materialiter am technischen Fortschritt partizipierte. "Und genau genommen", heißt es in einem Gedicht von Lars Gustafsson, "ist die Grammatik / selber eine Maschine". Die Sprachmaschine Literatur ist immer schon auf die risikoreiche Hoffnung angewiesen, daß die Macht des Maschinenwesens durch die Konfrontation mit sich selbst gebrochen werde, daß Gleiches durch das Gleiche geheilt werden möge. Wer den Fortschritt der Aufschreibesysteme mitmacht, könnte sich allemal auf die Unentbehrlichkeit dieser Homöopathie berufen. Und er könnte sich durch den Hölderlin-Vers bestätigt fühlen: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch." Von solch dialektischer Hoffnung beseelt ist denn offenbar auch die Modernisierungswelle, die parallel zur Raketendiskussion die schreibende Zunft ereilt hat. Das standesbewußte Festhalten am veralteten Schreibgerät verkommt zur Schrulligkeit, etwa bei Erich Fried, der einmal stolz im Fernsehen vorführte, wie er die gelähmte Leertaste seiner Schreibmaschine durch die Schwerkraft eines seitlich vom Wagen herabhängenden Gewichts mobilisiert. Abrüstungsgespräche hin oder her, die alten Abwehrgeschütze müssen modernisiert werden, und so weicht auch in den literarischen Arsenalen die gute alten Adler über kurz oder lang einem dieser Apples oder Ataris. Der alte schriftimmanente Selbstwiderspruch wird auf höherer Ebene ausgetragen. Jürg Laederachs Warnungen vor der "Taylorisierung des Schreibaktes" kommen selbstverständlich aus seiner "Neomaschine", die er ebenso braucht wie verdammt: "Ich kam zur Schreibhilfe mit dem Bildschirm: übers Theaterschreiben. Wer ein Stück schreibt, scheitert oft an einem technischen Detail...". Da muß Beelzebub her. Selbst bei der linksökologischen 'taz' sieht frau sich im Bemühen, den "Angriff der neuen Medien auf das Universum der Schrift und Literatur erfolgreich abzuwehren", zunehmend auf Unterstützung durch Textprogramme und Computersatz angewiesen. Und Vilém Flussers kulturkritische Verteidigung der Schrift rühmt sich, zugleich als "das erste wirkliche Nichtmehrbuch" (Verlagsanzeige) auch auf Diskette zu erscheinen. Das Rettende wächst sich aus. Auf jenen Hölderlin-Vers baute einst auch Heidegger. Aber in seinen Ohren klang er ganz anders; unvereinbar einem Denken, das es der Technik mit gleicher Münze heimzahlt. Das eben sei ja gerade das Wesen der modernen Technik, meinte der Fundamentalontologe, daß es vor lauter Technik den Blick verstelle auf das Sein. So bringe es den Menschen in die Gefahr, daß er "sich am Unverborgenen versieht und es mißdeutet". Er hatte auch einen Namen für diese Gefahr, einen höchst unpoetischen: das "Ge-stell". Wer sich hineinbegibt, der kommt darin um. So war denn auch jegliches Schriftgestell Anathema in der Todtnauberg-Hütte: Die Schreib-maschine verhüllt das Wesen des Schreibens und der Schrift. Sie entzieht dem Menschen den Wesensrang der Hand, ohne daß der Mensch diesen Entzug gebührend erfährt und erkennt, daß sich hier bereits ein Wandel des Bezugs des Seins zum Wesen des Menschen ereignet hat. Die Hand "handelt" nicht mehr wesensgemäß. Gilt das nicht erst recht für den Schrift-steller am Textcomputer? Alles halb so wild, kontern die Harry Manns. Nachdem er die noch zögernde Zunft mit seinen ersten Abenteuern am Terminal in Atem gehalten hatte, gab Dieter E. Zimmer im ZEIT-Feuilleton Entwarnung. Sein Kleines Vorwort zur Ära des Schreibcomputers war ein vorzügliches Entlastungsgutachten, das vielen aus der Seele gesprochen haben dürfte, die sich sorgten, wie man als homme de lettres den "Advent" des Wunderdings besteht. Erstens, so Zimmer, müsse man ja schließlich gerüstet sein: "Der Siegeszug des Textcomputers wäre nur noch aufzuhalten, wenn der ganzen zivilisierten Menscheit ein für allemal der Strom abgestellt wird." Die Konkurrenz schläft nicht. Und zweitens sei es zwar richtig, daß der Computer zu "hemmungsloser Schluderei" verführe, aber nur "jene Intelligenzen", die sowieso "von Literaten insgeheim für Analphabeten gehalten werden". Das kann man ihnen auch an der Computertastatur verklickern. Fazit: Heidegger irrt. Denn "mit der Hand handelt auch der Mensch, der eine 'Taste' be-'tastet'". Allemal bleibt der Schriftsteller auf dem goldenen Boden seines Hand-werks. Damit wären also die modernisierten Rechtschreib-Verteidiger aus dem Schneider. Und mit ihnen die Knöpfchendrücker-Kollegen im Pentagon - ein gewiß unbeabsichtigter Nebeneffekt der Zimmer-Argumentation. Aber wo liegt, in technischer Hinsicht, der Unterschied zwischen den literarischen und den militärischen Sternenkriegern? Die Tastatur eines Harry Mann unterscheidet sich von der eines "wirklichen" SDI-Kämpfers einzig durch die Kabel, an die sie angestöpselt ist. Ansonsten erleben beide beim Tippen dieselbe, gleich-gültige Realität, die mit den ausgelösten Wirkungen in keiner Korrelation mehr steht. Im Falle der elektronischen Kriegführung leuchtet die Bedrohlichkeit solcher Anonymisierung unmittelbar ein: wer die Schreie der Opfer nicht hört, ist zu Gewalttaten eher bereit. Aber traktiert nicht der Computerliterat auf vergleichbare Weise die Schrift? Bleibt es folgenlos, wenn sie, fern vom immergleichen Tastendruck, dem Automatismus der Stromstoß-Befehle ausgeliefert ist? Die "Typewriter Revolution" Schon mit der Einführung der Schreibmaschine vor gut hundert Jahren stellte sich die Technik zwischen die Hand und die Schrift, schon sie "erzeugt", wie ein Zeitgenosse staunt, durch einen einzigen kurzen Fingerdruck auf eine Taste gleich den ganzen fertigen Buchstaben an der richtigen Stelle des Papiers, das von der Hand des Schreibers nicht nur nicht berührt, sondern von dieser entfernt an einem ganz anderen Ort sich befindet als da, wo die Hände arbeiten. Welche Erfahrungen lassen sich also aus der Schreibmaschinenepoche für die Technikfolgenabschätzung der Computerschriftstellerei ziehen? Daß die Mechanisierung des Schreibens nicht ohne Effekt auf den Schreibenden bleiben konnte, davon war vor Heidegger schon Nietzsche überzeugt. Auf einen Brief Peter Gasts, der über den Einfluß von Feder- und Papierqualität auf Musik und Sprache sinniert, antwortete der Freund: "Sie haben Recht - unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken". Nietzsche schrieb diesen Satz - und das macht ihn für viele Medientheoretiker heute aufregend - mit der Schreibmaschine. Gegenläufig zum philosophischen Adepten Heidegger, war Nietzsche über das eiserne Ding ganz aus dem Häuschen. "Hurrah! Die Maschine ist eben in meine Wohnung eingezogen", jubilierte er, als die Transportschäden seiner 'Malling Hansen' endlich behoben waren. Beglückt über die Entlastung seiner extrem kurzsichtigen Augen, hämmerte er in die Tasten, was diese hergaben. Das war zwar nicht viel: da im feuchten Genueser Klima immer wieder das Farbband verklebte, war nach 15 Briefen und 32 Seiten mit Entwürfen zu Gedichten und Aphorismen, Schluß mit dem Tipp-Glück des Philosophen. Genug aber für die Entdecker des "mechanisierten Philosophen" (Kittler über Nietzsche), ihren Scharfsinn daran zu üben und von der Materialität der Kommunikation rückzuschließen auf deren Sinn. Faszinierendes kommt dabei zutage. So beginnt ein Schreibmaschinengedicht Nietzsches mit den Versen: LEG ICH MICH AUS SO LEG ICH MICH HINEIN SO MOEG EIN FREUD MEIN INTERPRETE SEIN Interprete Martin Stingelin belehrt naive Traditionalisten, die an einen kuriosen Tippfehler glauben mögen: Ein fehlendes 'N' erzählt die Geschichte von Deutungsversuchen, die im Anschluß an Nietzsches Schreibmaschinengedicht- und aphorismenentwürfe Buchstäblichkeit zu umgehen suchten; gerade im semantischen Effekt seines Fehlens reflektiert dieses 'N' dabei auf Buchstäblichkeit und Differentialität als Bedingung der Möglichkeit von Sprache als Bedeutendes. Solch exegetischem Eifer wird noch eine Schriftprobe des Philosophen (buchstäblich: "MELSDNDRGILSTHCZMOSMJY") bedeutungsschwanger. Fällt doch hier "Dichtung auf der Schreibmaschine an die Kontingenz der Bedingung ihrer Möglichkeit zurück." Schon möglich. Aber nur bedingt. Marshall McLuhans Formel "the medium is the message" war aufschlußreiche Provokation gegen den technologischen Relativismus, verführt aber zu den komplementären Verkürzungen eines technologischen Determinismus. So datiert Friedrich Kittler Nietzsches Wandlung zum Aphoristiker, den früheren Einfluß Schopenhauers unberücksichtigt lassend, auf die sechs Schreibmaschinenwochen des Jahres 1882. Den Telegrammstil, zu dem er angeblich jetzt erst überwechselt, verwünscht der Philosoph bereits 1879 als ein Stilmerkmal, "zu dem mich Kopf und Auge nöthigt". Auch die maschinengeschriebene Liebeskorrespondenz Kafkas muß als Objekt einer semiologischen Trichinenschau herhalten. Kittler rechnet ihr minutiös "4 von 12 Tippfehlern im Erstlingsbrief, also hochsignifikante 33%, bei den Pronomina 'ich' und 'Sie'" vor. Mag sein, daß bei Kafka nicht nur das i klemmte. Aber der Ausdruck mißlungener Individuation, der sein ganzes Werk durchzieht, bezieht seine Signifikanz gewiß nicht aus freudschen Fehlanschlägen. Literarische Qualitäten, das Problem sah auch Marx, sind aus den Produktionsbedingungen nicht unmittelbar abzuleiten. Erst recht nicht aus der Beschaffenheit des Schreibzeugs. Als Beleg dafür mag Sten Nadolnys Hinweis genügen: Mit dem zärtlich übers Papier mäandernden Gänsekiel sind die aggressivsten Parolen geschrieben worden, mit der wütend ratternden alten Erika die sanftesten Gedichte. Dennoch wirkt zweifellos die Mechanisierung der Lebenswelt zurück auf die Kultur und hinterläßt auch in der Schrift ihre Spuren. Bei Künstlern dürfte solches Reagieren aber allemal mehr sein als bloße Mimikry ans Gerät. Ja konträr: Kafka schreibt einmal an Felice, "man wird weinerlich bei der Schreibmaschine". Der Verlust an Ichhaftigkeit, den er beim Tippen empfunden haben mag, mindert nicht, sondern verstärkt den Ausdruckswillen des Ich. Das Individuelle schwindet nicht unter der Maschinenschrift, sondern wird durch die Bedrohung seines Verlustes erst recht zur die affektiven Gegenreaktion herausgefordert. Die mechanische Ferne entpuppt sich als nächste, ja "aggressive physische Nähe", wie sie Adorno ebenso an den Texten Kafkas ausmacht, wie an der Schreibmaschine: O romantischer und unerfahrener Einwand, der dort noch das Mißtrauen gegen die Technik bewahrt, wo der Gedanke längst der Technik zuhilfe kam. Denn nirgends ist der Kontakt zwischen Gedanken und Wort enger als auf der Schreibmaschine. ... Der Prozeß des Schreibens ist auf der Maschine aus einem zweidimensionalen wieder dreidimensional geworden. Die Worte, so viele Jahrhunderte hindurch bloß gelesen, lassen sich wieder abtasten; so bekommen wir sie vielleicht endlich in die Gewalt, nachdem wir allzulange ihrer fremden Herrschaft ausgeliefert waren. Das Paradoxon, von dem Adorno spricht: daß die Mechanisierung des Schreibens die ästhetische Distanz nicht vergrößert, sondern einzieht und dadurch den Ausdruck konkretistischer Plastizität annimmt, läßt sich von den Wort-Collagen der Dadaisten über die "materialen texte" (Bense) der konkrete Poesie bis zu Arno Schmidts Typoscripten verfolgen. Ein Satz aus Zettels Traum sagt: "'Wer Dichtung will, muß auch die Schreibmaschine wollen.'(?)" War bei handgeschriebenen Manuskripten die Spur ihrer Genese mit der Drucklegung getilgt, so wird Materialgebundenheit für diese Texte zur Existenzfrage - unmittelbar ausgesprochen in Enrights Typewriter Revolution : TAB e or not TAB e i.e. the ? Das Lakonische des Telegrammstils und die Kontingenz des Tippfehlers, in der Tat Phänomene, die erst mit der Schreibmaschine möglich waren, sind kein unentrinnbares Schicksal der Literatur. Sie können zum bewußten Stilmittel werden, das im Verweis auf sich selbst den Ort negativer Utopie bezeichnet. Bei Enright zum Beispiel, indem es das Kreativitätsversprechen der neuen Schreibtechniken in der ihnen eigenen Weise ironisch scheitern läßt: U 2 can b a Tepot Der Reaktionstyp dieser Art von Literatur entspricht demjenigen des Kleistschen Marionettentheaters. Was Karl Robert Mandelkow in seinem Aufsatz 'Orpheus und Maschine' über die Technik-Dichtung der Zwanziger Jahre feststellt, entspricht gewiß auch der Perspektive vieler Schreibmaschinendichtungen: Um die Poesie wiederzuerlangen muß die Erkenntnis, um mit Kleist zu sprechen, 'gleichsam durch ein Unendliches gegangen', muß der Mensch mit der von ihm selbst geschaffenen künstlichen Welt gewissermaßen identisch geworden sein, um ihr erst dann als ihr freier Schöpfer wieder souverän entgegentreten zu können. Läßt sich dieses Denkmodell einer dialektisch umschlagenden Entfremdung noch auf die am Computer erstellte Literatur übertragen? Was würde es für ein dichterisches Gebilde heißen, mit der Computerwelt identisch geworden zu sein? Sehen die Autorinnen und Autoren in der neuen Schreibtechnik noch eine Herausforderung ihrer Individualität? Orpheus in der Computerwelt "Den Teufel sehe ich darin - - - -". Lothar-Günther Buchheim erscheint die technische Schreibhilfe als Verkörperung des radikal Bösen. Während viele Vertreter seiner Generation daher weiter mannhaft zur eigenen Handschrift stehen ("meine Frau dechiffriert meine Texte"), plagen Eva Demski frauentypischere Bedenken: "Ich bin nicht aus Koketterie technisch unbegabt, sondern wirklich", schwört sie. "Außerdem find' ich das Grün der Buchstaben so verwesungsartig." Die Phänomenologie des Computers ist bis heute nachhaltig durch Orwells Big Brother geprägt. Karl Krolow fühlt sich vor ihm schlicht "unterlegen und hilflos". Ein typisches Computergedicht, das aus dieser Wahrnehmungsweise heraus geschrieben wurde, kehrt denn auch die Herrschaft des Formzwangs hervor, wie etwa bei Ralf Bülow: abs + rak + e + heorie ari + hme + ik geome + rie ma + hema + ik poesie Die Poesie in der Ära alphanumerischer Tastaturen als Summe abstrakter, Worte wie Gedanken zerhackender Mathematik, kleinlich und impulslos auf Tabulatorposition - sieht es so aus, das vielbeschworene Ende der Schrift? Noch im extremsten Konstruktivismus wäre sie ja, sozusagen als Hohlspur, anwesend. Doch diese Negativreaktion wurde von der Computerbranche um ihr Feindbild gebracht, seit diese sich selbst als Vorkämpferin gegen die rechnergraue Technokratie inszeniert. Den Auftakt machte ein spektakulärer Werbespot im Orwell-Jahr. Die Message: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like "1984" Seither wetteifern die Gerätehersteller um das Image, den computergerechten Menschen durch den menschengerechten Computer abzulösen. In der Tat: an die Stelle morbid glimmender Mattscheiben, deren Vorliebe für ein bestimmtes Trockenfutter aus spröden Befehlskürzeln ihre Bediener versklavte, sind ansprechende Schnittstellendesigns getreten, die sich mit Maus, Menüs und eingängiger Metaphorik komfortabel handhaben lassen. War es bei ersteren wie schon beim Typewriter noch möglich, Mensch und Maschine effektvoll zu kontrastieren, so sind sie auf Computern des "benutzerfreundlichen" Typs eine kooperative Symbiose eingegangen. Die ihn besitzen, fühlen sich beflügelt. Friedrich Christian Delius: Ja, der Wortprozessor stimuliert. Weil der Vorgang des Tippens schneller geht, fliegen die Gedanken in anderen Rhythmen auf den Bildschirm/auf Papier. Der Perfektibilismus des Geräts macht ihn alles andere als kleinlaut: Anfangs hatte ich die Befürchtung, ich könnte mich zu schnell mit dem erschreckend sauber Geschriebenen zufriedengeben. Aber das Mißtrauen gegen den immer druckreif scheinenden Text fördert aufs schönste die Leidenschaft des Änderns und Besserns. Das vermeintlich Endgültige als das ewig Vorläufige - die Vorstellung vom Computer als potenzierter Schreibmaschine reicht an diese Erfahrung nicht mehr heran. Die Tendenz scheint sich vielmehr umzukehren, wie Wolfgang Menge meint: Die Schreibmaschine zwingt immer schon zu einer Art Reinschrift. Der Computer gestattet es mir aber, ebenso spontan, ja im Grunde noch leichter zu schreiben als mit der Hand. Was die Waschmaschine für die industriegesegnete Hausfrau, ist für Willi Heinrich das neue Schreibwunder: Die physische und psychische Entlastung von ebenso mühsamer wie stupider Schreibarbeit bei Korrekturen, bei der Reinschrift, aber auch schon beim ersten Entwurf einer Manuskriptseite auf dem Bildschirm verhindert vorzeitige Ermüdung, erhält die Freude am Schreiben und fördert die Kreativität. Nietzsches "Hurrah" wirkt rührend wie Weihnachten bei armen Leuten angesichts des neuen Mitarbeiters. Karl Hoche lobt die "gigantische Arbeitserleichterung", Peter Glaser prophezeit gar "eine neue Geniebewegung". Und für Ulrich Mihr ist er schlicht ein "leibhaftiger 'elektronischer Eckermann'" Nicht an Orwells depressiver Düsternis, sondern an Huxleys penetrante Pillenfröhlichkeit erinnern fortan die Erlebnisberichte der euphorisierten Computerliteraten. Die Schreckensvision "Totaldatei bedient von alleswissenwollendem Zwangsneurotiker" (Laederach) wurde abgelöst von der des Karikaturisten, der die schnoddrige Anbiederei des elektronischen Kumpels aufs Korn nimmt: DU, ECHT DU, IRGENDWIE KANN ICH DIE DATEI TOTAL NICHT FINDEN. A> Das neue Soma heißt "Humanizing", ein Verfahren, das man in der Musikbranche dazu einsetzt, die technizistisch-strenge Regelmäßigkeit elektronischer Schlagzeuge unter einer Hülle kalkulierter Ungenauigkeiten zuzudecken. Aufs Humanizing verstehen sich aber auch die Computer nach dem Geschmack der neuen Generation - nicht umsonst war Apple-Chef Sculley war vormals PR-Mann bei Pepsi. Der "Happy Mac" grinst sein Herrchen oder Frauchen schon beim Einschalten an. Wer zum soundsovielten Mal eine bestimmte Programmroutine aufruft, sieht sich bisweilen geneckt durch die Aufforderung "Sag 'bitte!'". Und neuerdings läßt sich der bilderreiche Benutzerkomfort auch nach Gusto musikalisch untermalen, z.B. mit Händels 'Hallelujah' beim Einlegen einer Diskette. Die ernste Dialektik des Kleistschen Marionettentheaters funktioniert in der Operettenwelt solcher Computer nicht mehr. Die Suche nach dem Hintereingang des Paradieses im Durchgang durch die Abstraktion zerstreut sich in den künstlichen Paradiesen, die ihr unterwegs begegnen. Und verspürt der Schreibende doch noch einmal so etwas wie den Verlust ursprünglicher Grazie, so braucht er sein Leiden nur zu äußern und schon steht ein neues Programm-Update ins Haus. Wer am Computer gegen den Computer anzuschreiben versucht, findet sich unversehens als Ideenlieferant für die Software-Industrie. Warum also nicht gleich die neue Versöhnung von Mensch und Maschine besingen? Ralf Bülow hat auch dies versucht: Dieses Gedicht entstand am Nachmittag des 28. 1. 1982 mit Hilfe eines Computers. Er ist mir während dieser Zeit richtig sympathisch geworden. Goethe nannte seine Iphigenie "ganz verteufelt human", weil man ihr einfach nichts entgegensetzen konnte. Prae scriptum Auf die moderne Schreibtechnik will das ungraziöse Wort "Gestell" nicht mehr so recht passen. Wenn sie überhaupt noch zum Problem wird für die Schreibenden, dann ist es die unerträgliche Leichtigkeit der Schrift. Für Jürg Laederach ist die Geschichte der Schreibinstrumente auch die Geschichte der Desindividualisierung von Textbildern ... Die Materialität des Schreibens, die nie groß war, ist mit dem Computer fast ganz vernichtet. Gelang es noch, die Schreibmaschine als Hilfsgerät aus dem Bewußtsein wegzudrängen; war das Papier in der Gewichtigkeit seiner Materialität der Schreibmaschine irgendwie vergleichbar, etwa gleichgewichtig wie diese: so liefert der Computer keine Unmittelbar-Resultate getaner Arbeit mehr, es wäre denn die unheimlich und bodenlos flüchtig anmutende Schrift auf dem Bildschirm ... die Verflüssigung des Textes, willkommen bei Korrekturen, nimmt ihm gleichzeitig alles Definitive, nimmt ihm den letzten Rest der Erinnerung daran, daß die Schrift einst etwas war, das auf Gesetzestafeln geschrieben wurde. Der Computer ist das Ende des Runencharakters der Schrift... Sehnsucht nach Petroglyphen überkommt auch Peter O. Chotjewitz in seiner "Abneigung gegen zuviel Technik" beim Schreiben: "Einer der dümmsten Sätze, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, lautete: 'Steinzeit - nein danke!' Ich sage: Steinzeit - ja bitte!" Er kann sie haben. Zum liquiden Wesen der Computerschrift gehört es, daß sie alle nur erwünschten Manifestationen immer täuschender zu imitieren vermag. Primärverluste an Sinnlichkeit, die die Entwicklung der Simulationsmaschine begleiteten, werden von dieser auf sekundärer Ebene wieder eingeholt. Das betrifft nicht nur die Oberflächengestaltung, die schon jetzt mit der Schriftart "Shadow" dreidimensionaler als auf Papier wirkt und mit dem zuladbaren Schreibmaschinengeräusch jede Adler unter Plagiatsverdacht stellt. Es betrifft die Substanz literarischer Arbeitstechniken schlechthin, deren Geschichte sich am Leitfaden der technologischen Entwicklung des Textcomputers erzählen läßt - und zwar rückwärts: Im Anfang war die Montage. Und wo die Moderne zu Schere und Kleber griff, um collagierend zu experimentieren, da waren nun der "Cut"- und der "Paste"-Command, der es erlaubte, "verschiedene Varianten durchzuspielen, z.B. eine Passage an eine andere Stelle des Textes versetzen, nur mal zur Probe" (Delius). Die großen Romane des 19.Jahrhunderts speisten sich aus dem enzyklopädischen Eifer ihrer, für unerschöpflich geltenden, Schöpfer. Was müssen da nicht erst die Speicherkapazitäten elektronischer Datenbanken bewirken? Hans Wollschläger freut sich darauf, sie "als sich selbst ordnenden 'Zettelkasten' zu benutzen, aus dem sich verstreute Materialien und Notizen jederzeit nach Sinngruppen abrufen lassen." Und Peter Rühmkorf, Elektrotechnischem sonst eher abhold, wird schwach bei der Vorstellung eines Kabelanschlusses zur Uni-Bibliothek: und dann digital die Kataloge gewälzt und die gewünschten Bücher im Geschwindflug gemustert, wobei ich mir längere Zitate/Exzerpte postwendend aus dem Copykasten erhoffe. Zumindest hätte ich gern diesen schnellen Zugang zu allen Wörterbüchern der Welt: ein faustischer Trieb, ich möchte alles wissen. So befriedigt der technische Fortschritt eine altdeutsche Gelehrtensehnsucht. Mit dem Outline-Programm, das die Konzeption von Texten unterstützt, wird gar die Arbeitsweise zurückerobert, die Goethe bei seiner Faust -Dichtung anwandte. Der Gelegenheitsdichter schreibt über sein Konzeptionsverfahren: Die Teile sind in abgesonderten Lagen nach den Nummern eines ausführlichen Schemas hintereinander gelegt. Nun kann ich jeden Augenblick der Stimmung nutzen, um einzelne Teile weiter auszuführen und das ganze früher oder später zusammenzustellen. Goethes Erläuterung könnte - allenfalls ergänzt durch den Hinweis, daß die Schubladen selbstverständlich auch ihre Plätze wechseln können - in der Bedienungsanleitung der allerneuesten, auch "Ideenprozessor" genannten, Schreibhilfe stehen. Die Erfindung des Buchdrucks liquidierte die Individualität der klösterlichen Manufakturschrift. Was die Gutenberg-Technik zunächst in einem "Textur" genannten Verfahren kompensatorisch versuchte: die Angleichung an das handgemalte Schriftbild, schafft das Desktop Publishing. Der elektrifizierte Klosterschüler kann seinen Texten das persönliche Layout geben, mit Schriften, Farben, Illustrationen frei hantieren. Das WYSIWYG-Prinzip der druckgerechten Bildschirmdarstellung ("What You See Is What You Get") gewährt unmittelbare Einsicht in die Resultate der eigenen Arbeit. So gewinnt er seinen lange entbehrten Einfluß auf den publikatorischen Gestaltungsprozeß zurück. Das hat Auswirkungen auf die Buchindustrie: Die Selbstverlage sprießen derzeit aus dem Boden, und die großen lassen sich zunehmend mit druckfertigen Disketten beliefern. Dabei dürfte die von Claus Eurich befürchtete "Verantwortungsrückverlagerung alleine auf den Autor" manchem Lektoratsgeschädigten gar nicht so unlieb sein. So führt der technologische Fortschritt vom Text zur Textur zurück, der Computer - bislang Inbegriff der Desindividualisierung und Binärcodierung der Schrift - ausgerechnet er gibt ihr die augenfällige Präsenz zurück, die sie in den Ursprüngen besaß. Aber er macht bei den Anfängen der Schrift nicht halt. Die Schwelle von Platon zu Sokrates, von der schriftstellerischen Mortifikation der Worte zur Lebendigkeit mündlicher Rede, überschreitet das Spracherkennungssystem. Diskursfreudige, die sich vom Diktiergerät nur unzulänglich unterstützt sahen, weil es sie am Ende doch zur Trankription zwingt, finden in ihm endlich die allzeit bereite Schreibkraft. Das poetische Ausdrucksmittel des Steinzeitmenschen schließlich, das Bild, erfährt seine Renaissance im zunehmend ikonographischen, objektorientierten Arbeitsmodus, den die neuen Benutzeroberflächen bieten. Wolfgang Menge ist bereits dort, wo Chotjewitz so gerne sein wollte: "Sehen Sie, wir arbeiten doch alle nicht besonders gerne. Und da ist es schöner, mit all den kleinen Symbolen und dem ganzen Schnokus zu hantieren, als diese langweiligen trockenen Befehlstexte einzutippen." Die Vorschrift macht sich mit fortschreitender Programmiertechnik entbehrlich, restituiert den Zustand vor der Schrift. Nun liegt es leider in der Natur regressiver Sehnsüchte, daß sie den Gewalten erliegen, die sie fliehen. Und so entgeht auch die schreibtechnische Verwöhnungsgeschichte nicht dem pädagogischen Zeigefinger, den die protestantische Arbeitsmoral erhebt. Wer rastet, der rostet. Leicht läßt sich der Energieverlust erahnen, der daraus resultiert, daß der Computer sich allerlei produktionstechnischen Bedürfnissen so nachgiebig öffnet, wie die Fahrstühle in Douglas Adams' Raumfahrtgeschichten: Vorausschaubegabt, bringen sie ihr Klientel ans Ziel, bevor es überhaupt weiß, wo es hinwill; behagt ihnen aber ein Stockwerk nicht, dann palavern sie munter drauflos, was es doch alles für schöne Alternativen gibt. Blicken wir also den Gefahren ins Bildschirmauge. Das Montieren von Texten am Bildschirm geschieht so kinderleicht, daß zögernde Skrupel keine Chance mehr bekommen. Ganze Textbausteine wechseln wie Fertigteile ihre Plätze mit den jeweiligen Launen der Schreibenden, ohne daß sie der Widerstand des Materials zur Konzentration disziplinierte. Bestand Autorschaft einmal darin, gedankliche Fäden sukzessive aus dem Eigensinn der einzelnen Formulierungen herauszuarbeiten, so wird sie nun zum Arrangieren von Themenblöcken. Das abschließende Feilen hat dann oft nur noch Politurfunktion, kommt für das eigentliche Durchdringen des Textes zu spät. Einem verdächtig produktiven Kollegen galt schon Heines Frotzelei: "Verehrter Dumas, Sie haben gut schreiben, aber wer soll das alles lesen?" Die Verführung zur Vielschreiberei durch den Computer ist groß, da seine Aufnahmefähigkeit die sprichwörtliche Geduld des Papiers, die spätestens mit der zweiten Tipp-Ex-Schicht erschöpft ist, ins Unendliche ausdehnt. Die Omnipräsenz des externalisierten Gedächtnisses läßt der mémoire involontaire keinen Raum, wirkt der Meisterschaft der Beschränkung, die ja auch im Vergessenkönnen liegt, entgegen. Das flanierende Stöbern in Lexika und Katalogen ist beim elektronischen Direktzugriff um sein Zufallsmoment beraubt. Literaturlisten und Zettelkästen, früher mühevoll aus Einzelentdeckungen zusammegetragen und wie Schatzkästlein gehegt, schwemmen durch die leichte Handhabung von Computerkarteien und den Online-Nachschub von großen Datenbanken zu indifferenten Informationshalden auf. Manche suchen dem vorzubeugen, indem sie nach jedem Arbeitsgang ihre Dokumente von der Diskette löschen und so die filternden Verzögerungseffekte bei der Neueingabe zu nutzen. Aber kaum einer ist heute noch zu solch masochistischen Wegwerfgesten fähig. Entsorgungsstation ist dann der Leser. Konnte schon Goethes Schubladensystem als Vorwegnahme des Outline-Programms gelten, so wirft bereits die Kritik Wielands am Weimarer Kollegen ihre Bedenken voraus: "Überhaupt arbeitet Goethe so, daß er Stücke einzeln ausarbeitet und sie sehr lose zusammenhängt". Das Ergebnis sei eine "auffallende Ungleichheit". Goethe selbst nannte seinen 'Faust' eine Schwammfamilie. Wieweit seine Dichtung eine "Rumpelkiste" (Arno Schmidt) ist oder artistisches Kalkül, bleibt umstritten. Unbestritten dürfte aber die Gefahr sein, daß die Strukturierungshilfe des Ideenprozessors konzeptionelle Intelligenz verkümmern läßt. Eine Kinderkrankheit des Desktop Publishing, ist das überschwengliche Hantieren mit allen möglichen Schriftstilen und Formatierungen, die den Blick auf die Sprache verstellen. Je nach Veranlagung wird das "Mißtrauen gegen den immer druckreif scheinenden Text", von dem Delius sprach, mehr oder weniger ausgeprägt sein. Das geschichtslose, gleichsam immer schon "geliftete" Textbild, aus dem die Spuren der Korrekturarbeit getilgt sind, kann auch blenden. Wie die verstärkte Einbeziehung von Sprachelementen, die historisch vor der Schrift liegen, auf die literarischen Produzenten abfärbt, ist so ungewiß wie der Ursprung unserer Phylogenese. Weizenbaums Erfahrungen mit seinem Gesprächsprogramm ELIZA, Sherry Turkles Studien über die Auswirkungen der Computeranimation deuten auf die Wiederkehr animistischer Rituale. Zsuzsanna Gahse sucht den mythischen Schauder, der sie vorm Computer überläuft, mit der Beschwörungsformel "Du bist mein Stromer" zu bannen: "Diese Freundlichkeiten sind nicht ehrlich empfunden, sie sind nur Beschwichtigungsversuche, und was bleibt anderes übrig, als die tote/mechanische Umgebung zu beseelen." Noch Früheres werden vielleicht die berührungsempfindlichen Bildschirme ihren tastenden Bedienern entlocken - der Rückgang auf die reine Geste: Da da da... Poetry Processing Aber warum überhaupt noch selber schreiben? Auf eine Anfrage des Deutschen Literaturarchivs, ob sie mit dem Computer arbeite, zeigt sich Heike Doutiné enttäuscht, daß der sicher in ihrem Hause vorhandene Personalcomputer offenbar so unzulänglich programmiert ist, daß er die von Ihnen gestellten Fragen unter meinem namen nicht selbst beantworten kann. Ihre selbstbewußte Anwort - "Das Personal und der Computer bin ich selbst (IQ:164)" - könnte sich mit der Zeit einem heimtückischen Mißverständnis ausgesetzt sehen. Die Automatisierung des Schreibvorgangs vom Zeilenumbruch über Blocksatz und Silbentrennung bis zur Rechtschreibkorrektur durch Spell- und Stylechecking-Systeme, delegiert immer größere Anteile des schriftstellerischen Tuns an die Maschine. 'Ghostwriter' ist der vielsagende Titel eines Großprojekts der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung; Künstliche Intelligenz soll dabei wesentliche Anteile der sogenannten "vorpublikatorischen Prozesse", einschließlich der inhaltlichen Analyse und stilgerechten Komposition von Texten, übernehmen. 'Poetry-Processing'-Software gibt es bereits. Ein offenbar surrealistisch begabter Computer schrieb sich das folgende Gedicht: Schwindelnd laufen Drehzahlmesser Drehen ölige Affekte Während heimliche Gehirne Erfolge liefern über China Mögen die nichtautomatisierten Vertreter der Zunft ob solch öliger Affekte angewidert die Nase rümpfen - einer Science-Fiction-Phantasie von Stanislav Lem zufolge wird sich ihr Hochmut dereinst rächen. Sie erzählt die Geschichte vom "Elektrobarden", einem sprachbegabten Computer, der ebenfalls zunächst recht miserable Gedichte schreibt. Doch er verfügt über eingebaute Ehrgeizverstärker und ruhmsuchende Stromkreise, die jede Kritik zum Anlaß für Verbesserungen nehmen. Bald übertrifft er auch die avantgardistischsten Elaborate seiner menschlichen Kollegen an symbolischer Tiefe und magischer Unausdeutbarkeit. Als die ersten arbeitslos gewordenen Lyriker sich verzweifelt in den Freitod stürzen, greift der Konstrukteur des Elektrobarden - sei es aus Mitleid oder nur, weil er seine hohe Stromrechnung sieht - zur Zange. Doch sein Werk fleht ihn in so vollendeten Schwanengesängen an, daß der Mordplan unausgeführt bleibt ... Die Idee des Sprachcomputers gibt es, seit die scholastische Schriftkultur sich an sich selbst zu langweilen begann. Jonathan Swift ironisiert bereits ein abgedroschenes Klischee, als er seinen Gulliver an einen Textwebstuhl führt, mit dessen Hilfe "auch die unwissendste Person" Bücher schreiben kann: Durch Kurbeldrehungen werden einzelne Morpheme solange durcheinandergerührt, bis sich daraus sinnvolle Sätze ergeben. Die Sprech- und Denkmaschinen von Kempelens inspirierten Jean Paul wie E.T.A. Hoffmann zu phantasiereicher Technikfolgenabschätzung. Dagegen bleibt mancher Schriftsteller von heute hinter den Visionen der High-Tech-Industrie zurück: Während Kai Riedemann ein Hamburger Forschungsvorhaben fiktionalisiert, "ein Elektronengehirn zu schaffen, das genauso denkt und schreibt wie einstmals Johann Wolfgang von Goethe", werden nach dem Willen des KI-Forschers Edward A. Feigenbaum in den Bibliotheken der Zukunft die Bücher selbst untereinander kommunizieren, ihr Wissen austauschen und so vermehren. Kommentar seines Kollegen Marvin Minsky: "Vielleicht behalten sie uns als Haustiere." Freilich: sowenig die écriture automatique im Schreibautomaten aufgeht, wird die Literatur durch die Technik wegrationalisiert. Sie ist per se das Surplus ihrer mechanisierbaren Anteile - mögen die sich auf die Papierherstellung oder auf die Syntax erstrecken. Stets hat sie den technischen Standard zum Anlaß genommen, neue Stile, Formen, Gattungen zu entwickeln. So unterschiedlich wie die Schreibenden auf den Computer reagieren, so unterschiedlich reagieren ihre Werke. Auch unter gattungstheoretischem Aspekt gibt es den abgrenzenden oder adaptierenden Typ. Der abgrenzende Typ sieht sich angesichts der proteischen Wandlungsfähigkeit des Computers zu äußerter Reduktion und Askese gedrängt. Angesichts der virtuellen Unendlichkeit des Computers entsteht für den defensiv Schreibenden ein Bedürfnis nach Endlichkeit. "Ich bin altmodisch und schreibe wenig", begründet Michael Krüger seine Ablehnung des Computers. Damit kehrt er eine bislang geübte Merkmalsopposition um. Noch in der "Gebrauchsanweisung", die Enzensberger seinem Gedichtband landessprache beilegte, heißt es unter Punkt 3: das längste gedicht in diesem buch hat 274 zeilen. es wird an lukrez erinnert, der sich und seinen lesern 7415 zeilen abverlangt hat. Da läßt sich gegenüber der letzten Moderne noch viel reduzieren. Die Neubesetzung des "Altmodischen" qua Computerabstinenz zeigt sich aber nicht nur in quantitativer Hinsicht. Jurek Beckers Einschätzung, "daß die Arbiet an solchen Geräten der Kontemplation hinderlich ist", trifft wohl - nicht nur aus erzwungener technologischer Entsagung, sondern auch dem damit einhergehenden Zeitgefühl - die vorherrschende Grundstimmung der DDR-Literatur. Die narrative Konzentration und stilistische Zurückhaltung, die sie gemeinhin auszeichnen, haben ihr in der Vergangenheit oft den Ruch des Hausbackenen eingebracht. Sie könnten aber nun vor dem Hintergrund einer zunehmenden Diffussion und Dissoziation des computerisierten Schreibens an konterkarierender Frische gewinnen. Symptomatisch für ein neues Qualitätsbewußtsein ist der Ernst, mit dem Neil Postmans Thesen dort diskutiert werden, wo man wahrhaftig noch andere Sorgen hat als die, sich im Medienrausch zu Tode zu amüsieren. Der adaptierende Typ einer literarischen Reaktion auf die Computerwelt wird dagegen geneigt sein, mit Lyotard "sich die Welt des postmodernen Wissens als von einem Spiel vollständiger Information geleitet vorzustellen." Unter dieser Perspektive hat die Kunst ihre traditionelle Erkenntnisfunktion endgültig verloren. Da im Prinzip alles schon gesagt ist, kann die höchste Performativität per hypothesin nicht im Erwerb einer solchen Ergänzung bestehen. Sie ergibt sich aus einer neuen Anordnung von Daten, die eben einen 'Spielzug' darstellen. Diese neue Anordnung wird meist durch die Verknüpfung von Datenreihen erreicht, die bis dahin für unabhängig gehalten wurden. Diesem postmodernen Spieltrieb entspricht die Melange aus Text, Bild und Ton im elektronischen Gesamtkunstwerk, das unter dem Gattungsnamen "Multimedia" firmiert. Vom Standpunkt der Literatur aus betrachtet, trägt es allerdings einen resignativen Zug: das Eingeständnis, daß die Schrift nicht ohne die Unterstützung der anderen Künste innovativ sein könne. Doch eine solche "Verfransung", wie Adorno sie nicht ohne Untergangsdrohung nennt, muß nicht das letzte Wort sein, das aus dem Computer kommt. Arteigene Alternativen drängen sich überall dort auf, wo der Buchdruck Charakterschwächen zeigt. Doch, die hat er. So plagt beispielsweise Rousseau seine Herausgeber mit dem zweiten Diskurs über die Ungleichheit unter den Menschen durch "Fuß"noten, denen selbst maximale Übergrößen im Layout nicht passen wollen. Immer wieder schweift der Laissez-Faire-Pädagoge ab in seitenlangen Exkursen, und er hätte dabei wohl gerne zu weiteren Fußnoten gegriffen, - wenn ihm das Medium nicht Einhalt geboten hätte. Der Natur seines parataktischen Denkens wäre die Flexibilität der Bildschirmtexte und ihre Verknüpfbarkeit eher entgegengekommen. Diese Flexibilität erlaubt es, verschiedene Textebenen parallel zu handhaben, Schrift und Lektüre ihre spontanen Wege gehen zu lassen. "HyperText" heißt die dafür benötigte Software, und entdeckt hat sie - selbstredend - die Literatur. In seiner Erzählung Der Garten der Pfade, die sich verzweigen beschreibt Jorge Luis Borges ein vierdimensionales Dichtungsverfahren: Fang (sagen wir) hütet ein Geheimnis, ein Unbekannter klopft an seine Türe: Fang beschließt ihn zu töten. Natürlich gibt es verschiedene Lösungen. Fang kann den Eindringling töten, der Eindringling kann Fang töten; beide können davonkommen, beide können sterben usw. Im Werk von Ts´ui Pên kommen sämtliche Lösungen vor; jede einzelne ist der Ausgangspunkt neuer Verzweigungen... Was Borges im dreidimensionalen Medium Buch nur in Konditionalsätzen artikulieren konnte, hat Jay Bolter von der Universität North Carolina zur "Interactive Fiction" umgesetzt; sie eröffnet die vierte Dimension, indem sich der Leser interaktiv durch einen elektronischen "Story-Space" von 100 Episoden und 300 Knoten bewegt. Der Einwand, so werde Literatur zum Abenteuerspiel verflacht, liegt auf der Hand. Macht doch die Verfügbarkeit der vierten Dimension all die kunstvollen Arrangements obsolet, mit denen ein literarischer Text seine Beschränkung aufs sequentielle Wahrgenommenwerden sonst überwindet. Erzählerische Selbstermahnungen gegen das Abschweifen haben schließlich ihren stilistischen Reiz. Aber daß Not Tugenden gebiert, sanktioniert nicht die Not. Umberto Eco gesteht in der Nachschrift zum Namen der Rose , daß er seine labyrinthische Bibliothek am liebsten nach der Architektur des Rhizoms konstruiert hätte, wie es Deleuze beschreibt: kein Zentrum, keine Peripherie, sondern jeder Punkt gleich weit vom anderen entfernt. Was Labyrinthe nur durch Umleitungen erreichen, liegt in der Natur integrierter Schaltkreise: Weglängen sind in Zeitabständen praktisch nicht zu messen; die räumlichen Orientierungsmuster versagen, und der Diskettenleser verläuft sich aufs schönste im Hyperspace. Peter Glaser kann sich denn auch vorstellen, daß HyperText einmal in vergleichbarer Weise gattungsstiftend sein könnte, wie es der Bleistift für das Reisetagebuch und die Schreibmaschine für die konkrete Poesie war. Ob mehr dabei herauskommt, als beim Abenteuerspiel, wo sich ja die vierte Dimension doch nur im Herumtragen von Dingen und Tugenden erschöpft? Er möchte es ausprobieren. Der kompositorische Reiz dieser Aufgabe besteht darin, daß sie mit neuen Mitteln einzulösen versucht, worum sich die Literatur nicht erst seit Proust bemüht: nach musikalischem Vorbild die zeitliche Extension des Erzählen in der zeitlichen Intensität des Erlebens aufgehen zu lassen. Wie schwierig es ist, entsprechende epischen Partituren zu schreiben, weiß man aus gleichgearteten Problemen bei der parallelen Datenverarbeitung; es gibt die Hardware, aber keiner weiß sie so recht zu programmieren. Die Schrift läßt das Denken nicht aus ihrem sequentiellen Bann. Noch nicht? Neue Schreibexperimente bedürfen neuer Inspirationsquellen. Peter Glaser beschreibt sich als Stammgast im elektronischen Nachfolger des literarischen Kaffeehauses, der Mailbox: Man schaut öfter mal vorbei, nimmt was zu sich, läßt was da, arbeitet ein bißchen, schaut sich um. Oder man trifft jemanden, plaudert, und nimmt dann seine Briefe mit, die der elektronische Herr Oberkellner für einen aufbewahrt hat. Beckmesser werden freilich beim Flanieren auf den Terminal-Boulevards das kulturelle Flair der Zwanziger Jahre vermissen. Statt geistreicher Aperçus über Literatur und Kunst hagelt es Plattitüden aus Bits und Bytes. Aber Geschirrklappern und Geschwätz waren schon damals das notwendige Begleitgeräusch geistigen Schürfens. Daß auch im Computernetzwerk literarisch interessante Projekte reifen können, zeigt etwa der "Roman zum Mitmachen", der via Terminalkommunikation dazu einlädt, die traditionelle Kluft zwischen Autor und Leser produktiv aufzuheben. Womit die Literatur der Chip-Ära des weiteren zu rechnen hat, ist mit der Alternative "Abgrenzung oder Adaption" nicht in den Blick zu bekommen. Dieses Friß-oder-Stirb bleibt einem traditionellen Technikverständnis verhaftet, das für den Computer nicht mehr gilt. Zwangen herkömmliche Instrumente in ihrem unveränderlichen Sosein zur Entscheidung zwischen Negation und Affirmation, so gestattet das neue Medium eine dritte Verhaltensmöglichkeit: die Modifikation. Software ist eine Schreibware, die sich schreibend verändern läßt. Die Programmiersprachen haben mittlerweile das Niveau von Pidgin-Englisch erreicht - und das bedeutet in der Bildungshierarchie des Computertalks, gemessen am Fachchinesisch der Maschinencodes, mindestens Unterprima. Gestattet es doch jedem Laien, seine speziellen Anforderungen ans Arbeitsgerät nach Gusto zu gestalten, als handle es sich um die Zubereitung von Spaghetti-Saucen nach eigenen Rezeptideen. Der Schriftsteller der Zukunft wird - was er heute bisweilen schon ist, nun aber in erweitertem Sinne - zum sich selbst versorgenden Scriptwriter. Literarische und technologische Kreativität überschneiden sich hier, greifen gestaltend ineinander. Im Gegensatz zum Maschineschreiben erhält das Wort "Computerschreiben" dadurch eine interessante Doppelbedeutung. Der Computer entspricht dem neuesten Stand der Waffentechnik. Er verarbeitet Symbole. Auch die Literatur verarbeitet Symbole. Harry Mann spielt mit einer gefährlichen Waffe.

Über die Beziehung des Computers zur Literatur
![]()
Ts. Hamburg 1991 (geschrieben für den nicht publizierten Sonderband des Konkursbuchs über Computer).
Letter Invaders